Das A und O des Schimpansenschutzes. Ein Gespräch.
Daniel Hänni ist Geschäftsführer des Jane Goodall Instituts der Schweiz und forscht und arbeitet mit Schimpansen in Uganda.

Im Gespräch mit Daniel Hänni erfahren wir, wie er zum Schimpansen kam, was die Projekte des Instituts bezwecken und wie wichtig dabei die Mithilfe der Einheimischen ist. Regelmässig begleitet er cotravel-Studienreisen und organisiert Individualreisen mit seinem Team "Africa Wild Adventures GmbH".
Wie begann für Sie die Faszination für die Schimpansen?
Ich war schon im Primarschulalter begeistert von Affen. Damals hatte ich auf meinem Etui etwa 80 Krallenaffenarten Südamerikas aufgeschrieben, zum Teil mit lateinischen Namen. Sobald ich klettern konnte, war ich auf den Bäumen zu finden. Irgendwann habe ich jede freie Minute genutzt, um alleine in den Wald zu gehen.
Mit etwa 14 Jahren ging ich jede zweite Woche in den Zoo Zürich, habe mich vor das Affengehege gesetzt und die Schimpansen beobachtet. Manchmal auch die Gorillas und Gibbons. Am liebsten war ich ganz alleine da. Ich habe mich immer genervt, wenn andere Leute da waren, die blöde Bemerkungen machten.
Im Jahr 1977 habe ich dann erstmals einen Artikel über Jane Goodall in einem Tierheft gelesen. Das hat mich total fasziniert. Schon damals habe ich gedacht, ich würde ihr gerne mal bei der Arbeit helfen. Aber wie das so ist, macht man erst mal etwas anderes. Ich hatte nicht das Gymnasium besucht, sondern machte eine Lehre zum Hochbauzeichner.
Sie waren ausserdem – habe ich gelesen – auch sportlich sehr aktiv?
Ich war im Talentkader im Thurgau als 400-Meter-Läufer. Ich trainierte ca. 25 Stunden wöchentlich – neben meinem 45-Stunden Job. Mein Leben bestand also hauptsächlich aus Arbeit und Training. Mit einer Fussverletzung musste ich in die RS einrücken. Ich konnte deshalb während dieser Zeit nicht trainieren und kam dann mit einem schlechten Laufstil zurück. So musste ich viel nacharbeiten in der Leichtathletik; mit viel mehr Krafteinsatz. Irgendwann hätte ich wohl Doping nehmen müssen, um es an die Weltmeisterschaften zu schaffen. So habe ich diesen Teil von mir zurückgelassen.
Wie wurden Sie schliesslich Geschäftsführer für das Jane-Goodall-Institute Schweiz?
Im Job hatte ich mit Immobilien zu tun. Ich war dort involviert im Umweltmanagement, habe analysiert, wo sich die Firma gegenüber der Umwelt verbessern kann. Das war zwar spannend, aber nichts, wo ich mein Herzblut hineingeben wollte. Ich überlegte dann, was ich bereits in meiner Kindheit gerne gemacht hatte. So gelangte ich zurück zu den Affen. Ich machte also auf dem zweiten Bildungsweg die Matura und studierte danach Anthropologie. Als ich fand, dass ich mir genug Wissen angeeignet hatte, dachte ich darüber nach, wie ich Jane helfen konnte. Ich machte das nächste Jane-Goodall-Institute ausfindig: Das war in Deutschland. Ich nahm Kontakt auf und verbrachte zwei Tage mit dem Chef vor Ort. Anschliessend erzählte er Jane von seinem Treffen mit mir und ich bekam das «Go», um in der Schweiz ein Institut zu gründen. Das tat ich 2004. Bis 2008 arbeitete ich nebenbei im Management der Immobilienfirma weiter, denn die ersten vier Jahre arbeitete ich gratis für das Institut und musste zu Beginn sogar noch Geld investieren.
Wie haben Sie Jane Goodall kennen gelernt und was konnten Sie von ihr lernen?
Erstmals getroffen habe ich Jane an unserem Global Meeting in Florenz im Jahr 2005. Dieses Meeting findet alle zwei Jahre statt, bei dem Geschäftsführer/Innen aller Institute weltweit zusammen kommen. Auch Jane Goodall ist natürlich immer dabei.
Als ich Jane zum ersten Mal traf, machte es bei uns beiden Klick. Wir verstanden uns auf Anhieb gut. So war mir klar, dass das zumindest für die nächsten paar Jahre mein Weg sein würde. Ich und Jane sind ziemlich seelenverwandt. Wir sind nicht auf Konfrontation aus, prangern ungern Leute an, nur weil sie etwas gegen die Natur machen. Wir sind eher versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um Lösungen zu finden.
Von Jane lernte ich, Türen zu öffnen, damit andere auch profitieren können. Ich denke, es ist wichtig, nicht die gesamte Energie für sich zu behalten, sondern auch weiterzugeben. Oft hat man das Gefühl, dass, wenn man alle am eigenen Wissen teilhaben lässt, man etwa für eine Firma nicht mehr wertvoll und ersetzbar sei. Man hält deshalb manchmal Informationen zurück. Meiner Meinung nach ist das schlecht. Im Gegenteil ist es oft so, dass Leute, die viel erzählen, als gute Ressourcen wahrgenommen werden. Jane gibt nicht nur ihr Wissen weiter, sondern auch Chancen und Verbindungen.
Sie haben während mehrerer Jahre die Populationen der Schimpansen in Uganda analysiert. Wie gingen Sie dabei vor und was haben Sie gefunden?
Vielleicht gibt es Leute, die sich für einen Wurm interessieren, der nur in diesem Wald lebt. Aber mit diesem holt man kein Geld herein. Man muss eine «Flagship Species» haben, also eine prominente, attraktive Art, an die die Leute emotionalen Anschluss finden. Die Schimpansen, als nächste Verwandte von uns, bieten das.
Grundsätzlich gilt es zu wissen, wieviele Schimpansen an einem Ort leben, um dann sie und ihren Lebensraum zu schützen. Geht man in einen Wald hinein und findet heraus, dass da nur drei Schimpansen leben, dann lohnt sich das gar nicht. Lieber sucht man sich einen Ort mit mehr überlebensfähigen Populationen. Erst mal zählt man also, um zu erfahren, wie der Ist-Zustand aussieht. Diese Zählung sollte man alle paar Jahre wiederholen, um herauszufinden, ob die Schutzmassnahmen einen Einfluss auf die Schimpansenpopulation haben. Man kann so erkennen, wie die Projekte verlaufen, auch wie die Menschen zu den Schimpansen eingestellt sind. Gehen sie weniger in den Wald, gibt es mehr Wilderei, mehr illegale Holzfäller, mehr Schlingenfallen? Die Populationszählungen sind also ein sehr wichtiges Tool, um verstehen zu können, wie die Schimpansen auf äusserliche Einflüsse reagieren.
Wie werden diese Zählungen durchgeführt?
Um Schimpansenzählungen durchzuführen legt man im Normalfall Transekte fest, um nicht den gesamten Wald ablaufen zu müssen. Das heisst: Man läuft entlang von geraden Linien und macht von da aus Beobachtungen. Wir führten 3km lange Transekte durch – mit einem Abstand von je 1.5km zueinander. Mithilfe einer Software konnten die Koordinaten in ein GPS-Gerät eingefügt werden. Während der Erfasssung hält man auch andere Informationen fest, wie Gruppen von verschiedenen Affenarten, Büffeln, Elefanten, Antilopen und Waldschweinen. Aber auch illegale Aktivitäten von Wilderern und Holzfällern sowie die Struktur des Waldes, beispielsweise «Tropical High Forest closed» oder «open», um wiederzugeben, wie dicht der Wald ist.
Manchmal kommt man so an Orte, die man zuvor im dichten Wald durchlaufen hat - und nach fünf Jahren steht man in einem Feld. Das sieht man nicht, wenn man nicht in den Wald geht, ausser man hat aktuelle Satellitenaufnahmen. So schaut man sich also immer wieder an, was sich verändert hat.
…und so erhält man ein Bild von der Populationszahl?
Nicht so direkt. Man findet keine Schimpansen im Urwald, wenn sie nicht habituiert, also an die Menschen gewöhnt sind. Das Gute an den Schimpansen ist aber, dass sie Nester bauen. Läuft man langsam dem Transekt entlang (1km/h), kann man diese entdecken. Um einschätzen zu können, wie viele Schimpansen im Wald leben, zählt man also die Nester. Schimpansen bauen eigentlich jeden Tag ein neues Nest. Manchmal benutzen sie ein Nest auch zweimal, oder sie machen sich ein Tagesnest für eine kurze Siesta. Im Budongo-Wald beobachtete man für eine Studie eine Gruppe Schimpansen über 90 Tage und fand heraus, dass ein Schimpanse im Schnitt 1.09 Nester am Tag baut. Man zählt also die Nester, weiss aber auch, dass sie nach einer gewissen Zeit zerfallen. Auch hier haben wir Daten dazu, wie lange es dauert, bis die Nester nicht mehr als solche erkennbar sind. Auch fand man an habituierten Schimpansengruppen heraus, wie viele der Tiere überhaupt Nester bauen. Bis Schimpansen vierjährig sind, schlafen sie bei der Mutter im Nest. Im Budongo-Wald zählte man, dass etwa 17% der Gruppe Jungtiere sind. Unter Einbezug solcher Korrekturfaktoren lässt sich dann berechnen, wie viele Schimpansen ungefähr in diesem Wald vorhanden sein müssen.
Sie haben viel Zeit in Uganda verbracht. Wie beschreiben Sie jemandem Land und Leute?
Das ist schwierig – am liebsten würde ich es Ihnen zeigen. Uganda ist noch immer ein Drittweltland. Vor allem ausserhalb der Stadt. Ich war oft draussen in den Dörfern. Da ist immer noch alles sehr einfach. Die Lehmhütten erinnern an ein Leben vor vielen tausend Jahren. Viele Kinder winken freudig von den Strassenseiten, wenn ein Auto durchfährt - wobei sich die Situation auch langsam verändert. Die Kinder wissen, dass man mit den Touristen easy Geld verdienen kann, wenn diese sie ohne Schuhe oder mit zerrissenen Hosen sehen. Dann meinen die Leute, man müsse dem Kind einen Ball schenken oder für 5 Dollar ein Bild abkaufen. Das entspricht etwa dem, wie man früher Entwicklungshilfe leistete: Man hatte immer das Gefühl, man müsse den Menschen das geben, was wir haben - anstatt darauf zu hören, was sie eigentlich brauchen.
Aber grundsätzlich sind die Ugander extrem fröhliche und nette Leute, eher zurückhaltend und schüchtern am Anfang, aber sehr offen, wenn man auch offen auf sie zugeht. Uganda ist sehr schön und grün; es hat viel Wasser. Es herrscht eher wenig Hunger im Vergleich mit anderen afrikanischen Ländern und die Leute sind grundsätzlich zufrieden.
Welche Projekte werden zurzeit vom Institut unterstützt?
Einerseits das Bulindi-Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Matt McLennan, ein Freund von mir, führt das Projekt. Er machte 2007, als ich ihn kennenlernte, seine Doktorarbeit mit Schimpansen in fragmentierten Habitaten. Das Projekt sieht zu, dass diese fragmentierten Wälder, in denen Schimpansen leben, stehen bleiben. Denn sie sind wichtige Orte zwischen zwei grösseren Wäldern und bieten Schimpansen immer noch die Möglichkeit zwischen diesen Wäldern zu transferieren. Mittlerweile ist das in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung ganz gut gelungen. Wir pflanzen jedes Jahr 1-1.5 Millionen Bäume. Unser Institut finanziert die Baumschulen und stellt sicher, dass die Bäume an die Bauern verteilt werden. Pro Jahr sind es über 2000 Farmer, die mittlerweile in das Pflanzen involviert sind. Wir organisieren aber auch ein Fussballturnier, da es viele junge Männer gibt, die keine Arbeit haben oder beispielsweise Ziegel und Holzkohle herstellen, was der Natur schadet. An solchen Events kann sehr gut auf Umweltthemen aufmerksam gemacht werden. Da das Turnier im Radio übertragen wird, kann man damit wahnsinnig viele Leute erreichen. Auch Fussball kann so Teil des Schimpansenschutzes sein. Ausserdem machen wir Aufklärungsarbeit in den Communities. Zum Beispiel werden jedes Jahr einige Öfen gebaut, die weniger Holz und Holzkohle benötigen. So müssen die Leute weniger Holz verbrennen, was ebenfalls besser für die Umwelt ist.
Und Forschungsprojekte?
Im Bugoma-Wald gibt es eine Forschungsstation. Wir finanzieren da alle Leute von den Studenten bis zur Köchin, dem Wachmann und hin zu den Rangern, die täglich im Wald unterwegs sind. Gebiete mit einer Forschungsstation und Rangern, die den Wald täglich patroullieren, sind zu 90% geschützt. Direkte Forschungprojekte finanzieren wir dort momentan keine, indirekt aber natürlich schon, denn die Forscher, die unterwegs sind, sammeln Daten. Als ich noch in Uganda lebte, baute ich auch ein Education Center auf. Später gab ich dieses Projekt in die Hände des Jane-Goodall-Instituts Uganda, es wird aber noch immer durch uns finanziert – das heisst, wir machen auch immer noch Umweltbildung. Und je nachdem, welche Themen anstehen, finanzieren wir auch mal etwas anderes, z.B. Vorträge der AIDS-Hilfe, oder einen Workshop. Alles, was direkt oder indirekt mit dem Schimpansenschutz zu tun hat.
Im Kibale Wald finanzieren wir ein Fallen-Entfernungsprojekt, zusammen mit den Jane-Goodall-Instituten Holland und Österreich. Seit Juli letzten Jahres haben wir nun auch zwei Tierärzte, die vor Ort sein können, falls Schimpansen durch die Schlingenfallen verletzt werden. Sie schauen auch nach den Haustieren der Bevölkerung. Sie forschen zudem in und ausserhalb des Waldes daran, welche Parasiten oder Viren für die Haustiere oder die Wildtiere gefährlich werden könnten. Krankheiten, gegen die die Tiere keinen Schutz haben, werden anscheinend auch von Zugvögeln eingeschleppt. Man versucht dann möglichst schnell, einen Krankheitsausbruch einzudämmen.
Ngamba Island ist eine Schutzstation für Schimpansenwaisen im Viktoria See, die vom Jane Goodall Institut aufgebaut wurde. Schimpansen, die vom illegalen Handel mit Wildtieren betroffen sind und von der Regierung konfisziert werden konnten, finden hier ein neues Zuhause. Meist sind es Schimpansenbabys, die man nicht einfach wieder in den Wald auswildern kann. Über die letzten Jahre mussten wir sehr viel Geld investieren, weil durch die Covid-Pandemie der ganze Tourismus zusammengebrochen war und keine Touristen die Auffangstation besuchen konnten. Zudem gab es ein Hochwasser, das einige Gebäude auf der Insel zerstört hat. Eine Investition in den Hochwasserschutz und Renovationen waren nötig. Man muss immer wieder etwas machen, um ein solches Projekt instandzuhalten. Wir unterstützen noch einige andere Projekte, etwa eine Auffangstation in der Republic of Congo, aber unser Fokus liegt auf Uganda, denn die dortigen Begebenheiten kennen wir am Besten. Wir wissen, wie die Leute ticken, und können alles besser kontrollieren, weil wir die Sprache verstehen und langjährige Beziehungen pflegen.
Wie wichtig ist dabei die Mitarbeit der Einheimischen?
Das ist das A und O. Mir war von Anfang an immer klar, dass wenn wir ein Projekt machen nicht wollen, dass das unser Projekt bleibt. Ich will den Leuten das Gefühl geben, dass das ihr Projekt ist. Ich habe mich daher nie in den Vordergrund gestellt. Ich ging nie gerne an Meetings, wenn es Einheimische gab, die mich vertreten konnten. Ich wollte immer, dass wir die Leute fragen, was sie brauchen: Dass sie verstehen, was wir eigentlich wollen, und auch einen Nutzen darin erkennen. Wenige Einheimische wissen etwa, dass es nur im afrikanischen tropischen Waldgürtel Schimpansen gibt. Wenn sie die Touristen sehen, die die Berggorillas und Schimpansen besuchen wollen, gibt ihnen das einen gewissen Stolz – und dann wollen sie natürlich auch ihren Wald bewahren. Deshalb ist es auch wichtig, in die Schulen zu gehen, mit den Leuten zusammensitzen und zu erzählen, worum es geht. Wissensvermittlung ist unheimlich wichtig. Management-Gruppen, die sich selber organisieren, brauchen bald keine Anleitung und auch keine finanzielle Unterstützung mehr. Gewisse Bauern erhalten zu Beginn vielleicht eine Imkerausbildung, 10 Bienenkästen und einen Schutzanzug. Danach können sie ihr Wissen anderen Bauern weitergeben.
Mir ist immer am Liebsten, wenn fast ausschliesslich Einheimische Teil der Projekte sind. Ich nehme deshalb in der Regel auch keine Volontäre. Es wäre zwar eine tolle Erfahrung für den Voluntär, bringt aber den Leuten dort nichts. Sie sehen nur, dass Weisse kommen und ihnen noch die Jobs wegnehmen, die sie selbst besetzen könnten. Das fördert eine negative Einstellung. In eigentlich allen Projekten besetzten wir Leute, die vorher nicht in diesem Gebiet gearbeitet hatten, aber angeleitet wurden und jetzt einen Job haben. Sie gehen nach Hause in ihre Communities und erzählen davon. Sie verdienen Geld, können ihre Familie und vielleicht auch ihre Verwandten durchbringen. Ein solcher Job im Umweltschutz hat dann einen positiven Effekt auf die gesamte Community. Es ist wichtig, dass sich die Einheimischen entfalten und vielleicht sogar eine zusätzliche Ausbildung machen können. Mein erster Assistent zum Beispiel hatte zwar studiert – fand aber keinen Job. Dadurch, dass er mit mir arbeiten konnte, bekam er später eine Anstellung bei einer anderen Organisation und macht nun seine Doktorarbeit in England.
Uganda ist auch bekannt für Berggorillas. Heute geht es ihnen wieder besser. Worauf ist dies zurückzuführen?
Den Berggorillas geht es nur so gut wegen des Tourismus. Die Urwälder wurden ursprünglich abgeholzt. Wissenschaftler gaben dann zu bedenken, dass man auf lange Sicht mit dem Tourismus mehr verdienen könnte. Ende der 90er Jahre begann Uganda mit dem Berggorilla-Tourismus, und da kam dann auch tatsächlich viel Geld herein. Klar: Gewisse Gorillagruppen müssen damit leben, dass Menschen sie immer wieder besuchen kommen. Aus Untersuchungen wissen wir aber, dass die Tiere nicht gestresst sind.
Touristen bringen Devisen ins Land und ermöglichen der Bevölkerung bessere Lebensbedingungen. Dadurch, dass die Leute davon profitieren, ist der Druck auf den Wald enorm gesunken. In den Tourismus-Regionen gibt es zum Teil auch bessere Spitäler, da mit den Einnahmen aus dem Tourismus mehr Geld für die Infrastruktur zur Verfügung steht. Dank dessen konnte sich die Berggorilla-Population in den letzten 30 Jahren verdoppeln. Sie sind nicht mehr vom Aussterben bedroht, sondern «nur» noch stark gefährdet. Solange die politische Lage stabil bleibt und es keinen Krieg gibt, sollte den Gorillas eigentlich nichts passieren.
Sie leben zwischen der Schweiz und Uganda. Wo fühlen Sie sich eher zuhause?
Zuhause fühle ich mich eher wieder in der Schweiz. Ich fühlte mich extrem wohl in Uganda, auch die eine Seite meiner Familie ist von dort. In den letzten 10 Jahren reiste ich da aber nur noch: Ich war nicht mehr länger an einem Ort und deshalb auch nicht mehr in der Gemeinschaft verwurzelt. Zwischendurch besuche ich mal wieder ein Projekt, aber das sind nur noch sporadische kleine Ausflüge. Also ist mein Zuhause wieder in der Schweiz. Ich könnte es mir im Moment auch nicht vorstellen, wieder nach Uganda zurückzuziehen – nur schon wegen der Familie und der Kinder. Es ist aber auch nicht so, dass wir immer in der Schweiz bleiben müssen. Ich weiss ja nicht, was ich in 10 Jahren machen werde: Vielleicht baue ich mir dann in Uganda einen Alterssitz.
Wie können wir die Schimpansen und das Institut unterstützen?
Am Besten natürlich finanziell. Geld gibt uns den Spielraum, unsere Projekte effektiv umzusetzen. Es schafft auch die Möglichkeit, sie zu extrapolieren: Wenn auch vielleicht nicht eins zu eins an einen anderen Ort. Jeder Wald ist ja anders. Ob die gewohnte Methodik funktioniert und wie die örtliche Bevölkerung reagiert, muss man sich immer wieder neu anschauen. Das braucht viel Aufwand und Fingerspitzengefühl.
Von der Schweiz aus kann man natürlich auch reisen gehen, obwohl das Reisen stets auch negative Effekte auf die Umwelt hat. Doch wenn die Leute nicht nach Uganda in die Nationalpärke gehen, um Berggorillas und Schimpansen zu besuchen, kommt zu wenig Geld ins Land, um die Natur zu schützen. Dann kommt die Industrie und investiert. So kann ein ganzer Wald abgeholzt werden, wenn dort Zuckerrohrplantagen mehr Profit bringen als die Touristen. Lieber schützt man aber einen Nationalpark und stellt dort Ranger ein. Der Besitzer einer Plantage verdient zwar viel Geld, doch die Arbeiter schneiden für vielleicht einen Franken täglich Zuckerrohr. Nicht nur darum würden die meisten Ugander es vorziehen, einen Job als Ranger oder sonst im Tourismusbereich zu haben. Das ist ganz allgemein viel spannender, als für eine Firma zu arbeiten, einen monotonen Job zu machen und zudem ausgebeutet zu werden.
Für die Schimpansen wäre es wichtig, dass der Naturschutz parallel mit der Wirtschaft mitwachsen würde, sodass er auch ein gewisses Gewicht gegenüber anderen, destruktiven Wirtschaftszweigen aufbaut. Je mehr Geld mit dem Tourismus verdient wird, desto höher der Stellenwert der Wälder, Nationalpärke und somit auch der Tiere.
Wir danken Ihnen vielmals für das aufschlussreiche Gespräch!
Jane Goodall Institut Schweiz
Gruppenreisen CoTravel
Individualreisen Uganda: Africa Wild Adventures GmbH

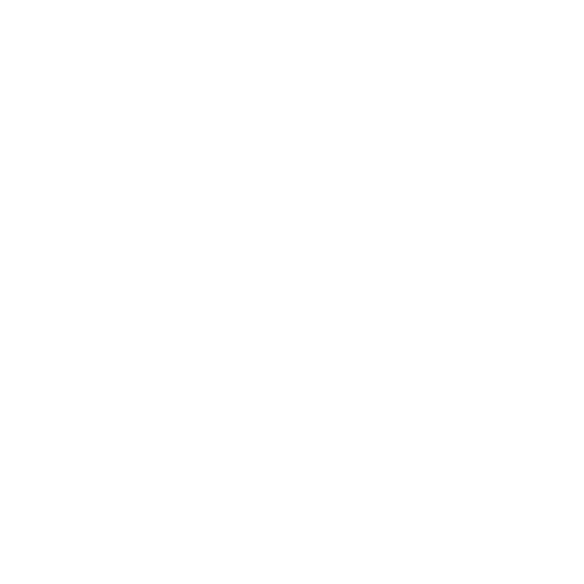



Kommentare ()